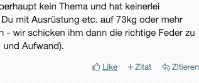Leider gibt es Dinge, bei denen sich niemand die Mühe macht, sie einmal zu differenzieren.
Und spätestens, wenn man etwas Neues verkaufen will (ob sinnvoll oder nicht), kann das sogar kontraproduktiv sein.
Wer zu Beginn der 90er Jahre einmal 18mm-
Reifen mit 9 bar Luftdruck gefahren hat, weiß, wie spürbar leicht ein
Reifen rollen kann.
Wenn ein „breiter
Reifen schneller“ sein soll, muß man sich die Frage stellen, was ihn denn schnell macht.
Ich versuche es einmal, stark vereinfacht und verkürzt:
Ein schmaler
Reifen verträgt, technisch bedingt, einen höheren Druck als ein breiter
Reifen.
Bei Nenndruck (!) verformt sich ein schmaler
Reifen mit hohem Druck weniger. Es wird weniger Material verformt, er „walkt“ also weniger. Weniger Walkverluste bedeutet weniger Energieverlust.
Es wird zwar häufig argumentiert, daß ein schmaler
Reifen, der eine schmalere, dafür eine längere Aufstandsfläche hat, einen größeren „Wulst“ vor sich herschiebt, doch hat noch nie jemand diese Verluste beziffern können.
Die größeren Verluste liegen also nicht im reinen Rollwiderstand (sonst würden Bahnfahrer ebenso breite
Reifen fahren wie Straßenfahrer) – sondern in der Federung.
Und hier muß man zwischen Federung und Dämpfung unterscheiden.
Bildlich gesprochen: bei einer Federung kommt die Energie, die man in ein System hineingibt, (größtenteils) wieder heraus. Bei einer Dämpfung wird sie im System umgewandelt.
Als Vergleich vielleicht ein Hartgummiball („Flummi“) und eine Knetgummikugel:
läßt man sie aus einiger Höhe fallen, springt der Flummi einige Male auf, bevor er liegenbleibt. Die Knetgummikugel bleibt nach dem Aufprall liegen. Die kinetische Energie ging in der Verformung verloren, denn das Knetgummi ist platt.
Der Flummi federt, Knetgummi dämpft.
Ähnlich ist es bei
Reifen: prallhart aufgepumpte
Reifen federn. Bei jeder Unebenheit, jeder kleinen Erhöhung der Fahrbahn müssen Rad und Fahrer (= „Systemgewicht“) in Sekundenbruchteilen angehoben werden.
Diese Hubarbeit kostet erhebliche Energie. Dazu kommt, daß die gesamte Masse ähnlich einem Wackelpudding in Schwingung versetzt wird. Auch dabei geht viel Energie verloren. Wer also genügend Fettdepots mit sich trägt, wird dies deutlich spüren. Besonders deutlich wird das beim Überfahren von Kopfsteinpflaster. Da „schwabbelt“ dann so einiges....
Reduziert man nun den Luftdruck, wir die Hubarbeit beim Überfahren von Unebenheiten deutlich geringer. Ebenso reduzieren sich die Schwingungsverluste.
Um aber nicht ständig Durchschläge zu erleiden, muß man das Volumen und somit auch den Durchmesser der
Reifen vergrößern.
Ein breiter
Reifen mit geringerem Luftdruck hat also keinen geringeren Rollwiderstand. Er sorgt für deutlich weniger Verluste durch Hubarbeit und Federung/Schwingung. Er gibt nach, er dämpft.
Die superschmalen 18-mm-
Reifen, die um 1989 aufkamen, verschwanden in dem Moment, als die hochgebauten Aerofelgen in Mode kamen.
Diese waren vertikal so bockhart, daß von Komfort nicht mehr die Rede sein konnte.
Dazu kam, daß der aufkommende 8-fach-Kranz für ein deutlich asymmetrischeres Hinterrad sorgte, die Vorspannung der kranzseitigen Speichen deutlich zunahm – und die vertikale Härte der Laufräder ebenso.
Immer höhere Felgenprofile, immer größere Asymmetrie des Hinterrades durch immer mehr Zahnkränze – da müssen dann schon richtig dicke Schlappen drauf, um nicht Hirn und Hintern durchgeprügelt zu bekommen.
Das wird dann mit mehr Reifengewicht, größerer Massenträgheit, größerer Windangriffsfläche etc. erkauft.
Wer schmale
Reifen mit hohem Druck fahren möchte, um in den Genuß geringer Reibungsverluste/Walkarbeit zu kommen, muß dafür sorgen, daß andere Komponenten die Dämpfung übernehmen.
Sicherlich werden sich nun viele Kritiker den Mund über meine Darstellung zerreißen.
Am besten macht jeder seine eigenen Erfahrungen.